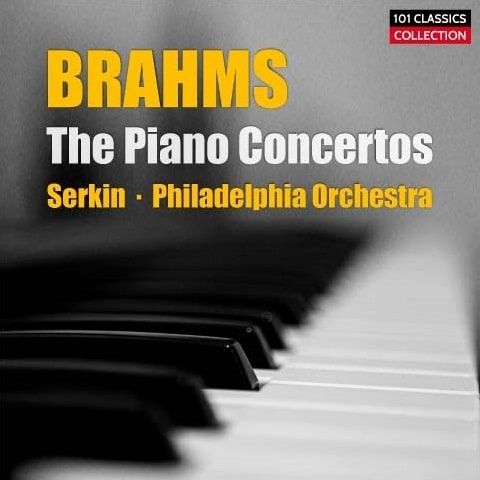
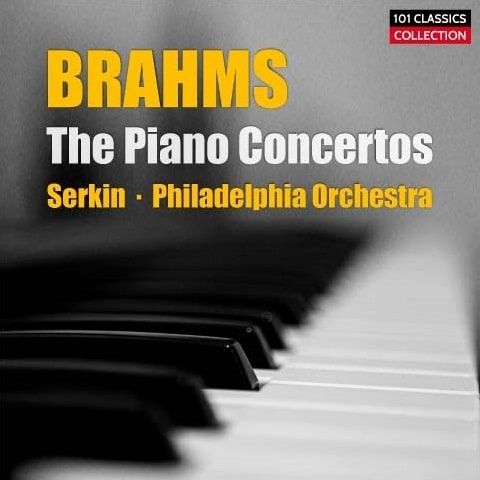
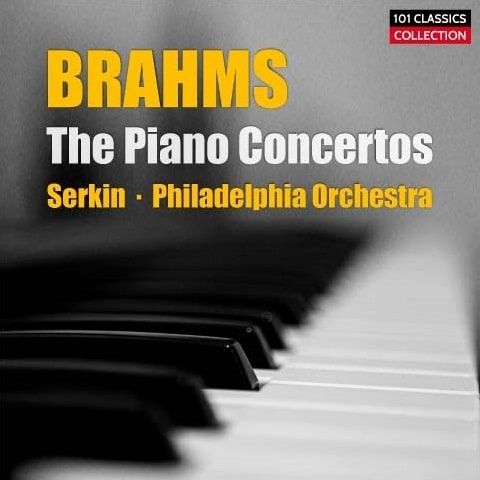
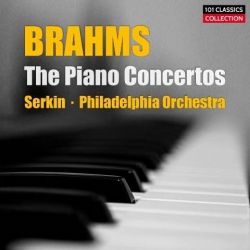
Musik-Album im MP3-Format
Gesamtlänge: 1:32:54 h h
Audioformat: MP3 – High Quality (320 kbit/s)
Bildnachweis: Foto von Lucas Santos auf Unsplash
→ ARTHUR RUBINSTEIN / CHICAGO SYMPHONY ORCHESTRA
Die ersten Aufführungen mit Brahms als Solisten 1859 waren große Mißerfolge und stürzten Brahms in eine schwere Schaffenskrise: "Zum Schluß versuchten drei Hände ineinander zu fallen, worauf aber von allen Seiten ein ganz klares Zischen solche Demonstrationen verbot" beschrieb Brahms den verhaltenen "Applaus" nach einer Aufführung im Leipziger Gewandhaus. Der erste Satz - mit seinen ungestümen Klaviertrillern - überforderte die damaligen Zuhörer. Sie waren an virtuose Klavierakrobatik á la Liszt gewohnt. Der langsame zweite Satz (Adagio) war ursprünglich überschrieben mit "Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn". Die Streicher betonen diesen religiösen Charakter, sie ziehen gewissermaßen langsam wie ein Pilgerzug am Hörer vorbei. Das Finale setzt widerspenstig und kraftvoll ein. Das Klavier übernimmt von Beginn an die Führung. Trotzig aufbegehrende Passagen und sanftes lyrisches Spiel wechseln sich ab. Immer spielerischer werden die Klavierfiguren. Mit freudig bewegtem Spiel des Solisten und einem frohen Paukenwirbel schließt das Stück.
Mehr als zwanzig Jahre waren vergangen, ehe Brahms nach dem eklatanten Mißerfolg seines ersten Klavierkonzerts sich diesem Genre wieder widmete. Es ist im viersätzigen Aufbau (wie bei einer Sinfonie) und im Charakter gänzlich verschieden vom dramatisch angespannten Erstlingswerk: Der erste Satz beginnt zart mit einem Hornsolo. Nach einem kurzen Dialog zwischen Horn und Klavier folgt ein sich mächtig entwickelndes Klaviersolo bis zum großen Einsatz des ganzen Orchesters mit dem Hauptthema. Die Heiterkeit des ersten Satzes wird in Satz zwei abgelöst durch den dramatischen Einsatz des Klaviers gleich zu Beginn. Den dritten Satz eröffnet völlig überraschend das Solo-Cello mit einer wunderschönen innigen Melodie. Das bald einsetzende Klavier knüpft daran aber nicht an, sondern kommentiert die thematischen Ideen des Orchesters. Abweichend von der üblichen dreisätzigen Form eines Konzerts komponierte Brahms auch einen vierten Satz: Das Klavier beginnt den Reigen origineller, reizvoller und harmonischer Melodien bis der Hauptgedanke einen triumphalen Sieg davon trägt. Das Konzert wurde 1881 in Budapest mit Brahms als Klaviersolisten uraufgeführt.
Rudolf Serkin bringt sowohl die jugendliche Dramatik des ersten Konzerts in d-Moll als auch die reife, symphonische Weite des zweiten Konzerts in B-Dur mit beeindruckender Tiefe und gestalterischer Kraft zum Ausdruck. Das Philadelphia Orchestra unter Eugene Ormandy bietet dabei eine luxuriöse orchestrale Grundlage, klangschön, geschmeidig und mit großer gestalterischer Sensibilität, was gut mit Serkins klarer und kraftvoller Spielweise kontrastiert. Serkin verzichtet er auf jede Effekthascherei und nähert sich Brahms’ Musik mit tiefer Ernsthaftigkeit und klarem architektonischen Gespür.
Fazit: Eine mustergültige Interpretation beider Brahms-Klavierkonzerte – tief empfunden, klanglich prachtvoll und pianistisch auf höchstem Niveau. Für Liebhaber romantischer Klavierkonzerte ist diese Aufnahme ein Highlight.
Technische Daten
Vielleicht gefällt Ihnen auch